Online-Steueranmeldungen sind jetzt Pflicht
Für Steueranmeldungen und Lohnsteuerbescheinigungen beginnt am 1. Januar 2005 die papierlose Zeit. Denn das Steueränderungsgesetz 2003 sieht vor, dass in Zukunft die Lohnsteuerbescheinigungen, die Lohnsteueranmeldungen und die Umsatzsteuervoranmeldungen auf elektronischem Weg an das Finanzamt übertragen werden müssen.
Bei der Lohnsteuer gilt dies erstmals für die Lohnabrechnung 2004, die Sie dann bis zum 28. Februar 2005 an das Finanzamt übermitteln müssen; der Arbeitnehmer soll aber weiterhin einen Ausdruck der elektronischen Daten erhalten. Natürlich muss dann auch im laufenden Jahr so verfahren werden, falls das Arbeitsverhältnis enden sollte. Das Gesetz regelt im Einzelnen, welche Angaben der Datensatz enthalten muss. Für die Datenfernübertragung muss der Arbeitgeber aus dem Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Arbeitnehmers ein Ordnungsmerkmal, die so genannte eTIN, bilden. Der Arbeitgeber muss den Mitarbeitern einen Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit einem Ausdruck der eTIN aushändigen. Die bisherige Eintragung auf der Lohnsteuerkarte entfällt ab 2005.
Im Fall der Umsatzsteuer beschränkt sich die Pflicht zur elektronischen Übermittlung auf die Umsatzsteuervoranmeldungen und gilt erstmals für Voranmeldezeiträume, die nach dem 31. Dezember 2004 enden. Falls Sie eine monatliche Voranmeldung durchführen und keine Dauerfristverlängerung haben, müssen Sie also die erste Voranmeldung bis zum 10. Februar 2005 in elektronischer Form an das Finanzamt übermitteln.
Bis zum 31. März 2005 besteht allerdings eine allgemeine Schonfrist. Solange können Sie noch Steueranmeldungen auf Papier an Ihr Finanzamt schicken. Das Finanzamt schickt Ihnen aber nicht mehr die erforderlichen Formulare zu, Sie können sich die Formulare im Internet ausdrucken oder bei Ihrem Finanzamt abholen.
In Härtefällen erlaubt das Finanzamt auch dauerhaft weiterhin die Abgabe der Voranmeldungen auf den amtlichen Formularen. Dazu müssen Sie aber einen Antrag stellen, in dem Sie begründen müssen, warum es für Sie nicht zumutbar ist, die Daten elektronisch zu übermitteln. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn im Unternehmen keine PCs oder kein Internetanschluss vorhanden ist. Auch ist für die Übermittlung der Daten die ELSTER-Software notwendig, die von der Finanzverwaltung bisher nur für Windows-PCs bereitgestellt wird. Soweit Sie nur andere Betriebssysteme einsetzen (Linux, MacOS etc.), kann auch ein Härtefall vorliegen.
Weitere Hinweise zur Abgabe der elektronischen Steuererklärungen erhalten Sie auf der Website der ELSTER-Software und der Finanzbehörden und natürlich von uns. Denn wenn Sie sich nicht selbst um die Übermittlung der Daten kümmern möchten, kann dies auch der Steuerberater für Sie übernehmen. Sie können aber auch eine CD-ROM mit dem Programm ELSTER (= ELektronische STeuerERklärung) bei Ihrem Finanzamt bekommen.
Abschließend ist allerdings noch anzumerken, dass das ELSTER- Verfahren noch gravierende Sicherheitsmängel aufweist. Bevor ein Unternehmen am ELSTER-Verfahren für Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen teilnehmen darf, muss es nämlich einmalig die Richtigkeit seiner Angaben mit einer schriftlichen Teilnahmeerklärung versichern. Danach erfolgen die Anmeldungen zwar verschlüsselt, aber ohne Authentifizierung gegenüber dem Finanzamt.
Wer dem Unternehmen einen Streich spielen will, kann für das Unternehmen eine völlig überhöhte Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Alles, was der Missetäter dafür benötigt, ist die Steuernummer des Unternehmens, die seit 2004 zwingend auf jeder Rechnung angegeben werden muss, wenn keine Umsatzsteueridentnummer vorliegt. Hat das Unternehmen eine Abbuchungsermächtigung erteilt, wird das Finanzamt den Betrag abbuchen. Die Folgen kann man sich leicht ausmalen: Im schlimmsten Fall werden die Konten gesperrt, und Überweisungen können nicht mehr ausgeführt werden. Der Ärger ist groß, selbst wenn das Finanzamt nach wenigen Tagen den Betrag zurücküberweist. Wie es weitergeht, ist noch nicht klar. Ab 2006 will die Finanzverwaltung zwar auch eine Authentifizierung durchführen, bis dahin rät der Bundesdatenschutzbeauftragte jedoch zur Abschaltung des ELSTER-Verfahrens.
Neue Sachbezugswerte und Pauschbeträge für 2005
Auch für 2005 hat das Bundesfinanzministerium wieder die Sachbezugsverordnung geändert. Dadurch wird der Verpflegungswert für 2005 um monatlich 2,55 Euro erhöht. Der Wert eines Mittag- oder Abendessens beträgt jetzt 2,61 Euro und der Wert eines Frühstücks 1,46 Euro. Diese Werte sind sowohl für die freie oder verbilligte Abgabe von Mahlzeiten als auch für Kantinenmahlzeiten und die Bewertung von Essensmarken von Bedeutung. Bei Essensmarken können die Werte allerdings nur dann verwendet werden, wenn deren Verrechnungswert den amtlichen Sachbezugswert um nicht mehr als 3,10 Euro übersteigt. Die Werte gelten übrigens genauso im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung.
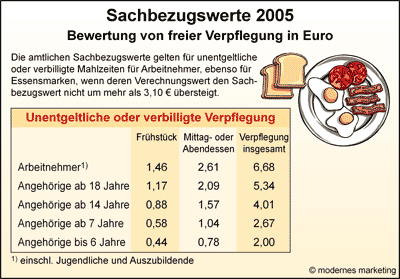
Ebenfalls erhöht wurden die Sachbezugswerte für freie Unterkunft. Diese betragen jetzt 6,47 Euro in Westdeutschland und 5,93 Euro in Ostdeutschland pro Tag für die Einzelunterbringung. Weiterhin hat das Bundesfinanzministerium auch neue Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben festgelegt, die im BMF-Schreiben vom 11. November 2004 nachzulesen sind.
Änderungen im Sozialrecht durch Hartz IV
Durch das Hartz IV-Gesetz werden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab dem 1. Januar 2005 zum Arbeitslosengeld II (ALG II) zusammengeführt. Die Auszahlung der Arbeitslosengelder wird dabei weiterhin durch die Bundesagentur für Arbeit erfolgen. Diese übernimmt auch weiterhin Eingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt sowie die Auszahlung der Sozialgelder. Die Kommunen dagegen zahlen Wohn- und Heizgeld und tragen die Kosten für die Schuldner- und Suchtberatung und für die Kinderbetreuung und häusliche Pflege.
Die wichtigste Änderung ist Zusammensetzung und Höhe des neuen ALG II, das anders als das normale Arbeitslosengeld keine Versicherungsleistung ist. Entsprechend werden die erforderlichen Mittel nicht von der beitragsgespeisten Arbeitslosenversicherung sondern aus Steuermitteln aufgebracht. Auch orientiert sich das Arbeitslosengeld II, vergleichbar der bisherigen Sozialhilfe, nicht am letzten Arbeitseinkommen, sondern es wird bedarfsabhängig festgesetzt. Entgegen ersten Plänen wird das ALG II erstmalig bereits Anfang Januar 2005 an alle Berechtigten ausgezahlt.

Das neue Arbeitslosengeld II sowie das Sozialgeld orientieren sich an einer pauschalierten monatlichen Regelleistung, die sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen:
-
Alleinstehende und Alleinerziehende erhalten als Grundbetrag 345 Euro (alte Bundesländer einschließlich Berlin) bzw. 331 Euro (neue Bundesländer ohne).
-
Für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs wird ein Zuschlag von 207 / 199 Euro (West / Ost) gewährt, und ab dem 15. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gibt es 276 / 265 Euro extra.
-
Für einen Partner ab Beginn des 19. Lebensjahrs beträgt der Zuschlag schließlich 311 / 298 Euro.
Leistungen für Mehrbedarf werden pauschalisiert gewährt, Heiz- und Unterkunftskosten in tatsächlicher Höhe erstattet. Die Übernahme von Mietschulden erfolgt auf Darlehensbasis.
Voraussetzung für die Gewährung der Unterstützungszahlungen ist, dass der Empfänger soweit vorhanden auch eigenes Vermögen einbringt. Neben diversen einzelfallabhängigen Freibeträgen hat jeder Hilfeempfänger für Barvermögen einen altersabhängigen Grundfreibetrag von 200 Euro je Lebensjahr, jedoch mindestens 4.100 Euro und maximal 13.000 Euro pro Person. Wer vor dem 1. Januar 1948 geboren ist, erhält sogar einen deutlich höheren Grundfreibetrag von 520 Euro je Lebensjahr, maximal 33.800 Euro.
Ein pauschaler Freibetrag von 750 Euro steht jedem als Rücklage für notwendige Anschaffungen zu. Für Vermögen, das der Altersvorsorge dient, wird ein weiterer Freibetrag von 200 Euro je Lebensjahr gewährt, maximal 13.000 Euro. Riesterverträge werden nicht auf die Freibeträge oder die Unterstützungszahlungen angerechnet.
Kinder werden als zulageberechtigt angesehen, wenn deren eigenes Vermögen maximal 4.100 Euro beträgt, wobei auch hier die 750 Euro an Rücklagen für besondere Anschaffungen hinzukommen. Die alte Fassung, in der dieser Freibetrag von 4.100 Euro erst für Kinder ab 13 Jahren gilt, wurde inzwischen aufgehoben. Ebenfalls grundsätzlich geschützt sind eine selbst genutzte Eigentumswohnung oder ein Haus von angemessener Größe und ein Auto.
Wer bisher noch Arbeitslosengeld bekommt, erhält beim Übergang zum Arbeitslosengeld II einen auf maximal zwei Jahre befristeten Zuschlag. Der beläuft sich im ersten Jahr auf zwei Drittel der Differenz zwischen dem bisherigen Arbeitslosengeld und dem ALG II, maximal jedoch 160 Euro für Alleinstehende, 320 Euro für nicht getrennt lebende Ehepartner und 60 Euro für jedes minderjährige Kind, das mit dem Zuschlagsberechtigten zusammenlebt. Im zweiten Jahr halbiert sich der Zuschlag auf ein Drittel der Differenz.
Außerdem besteht die Möglichkeit, eine vorhandene Erwerbstätigkeit fortzuführen, ohne dass der volle Verdienst auf die staatliche Unterstützung angerechnet wird. Die Anrechnung des Bruttolohns erfolgt in gestaffelter Form:
-
Wenn der Bruttolohn 400 Euro nicht übersteigt, werden 15 % des daraus resultierenden Nettoeinkommens nicht auf das ALG II angerechnet.
-
Beträgt der Bruttolohn mehr als 400 Euro, wird der überschießende Anteil des Nettoeinkommens mit 30 % nicht angerechnet; für das Nettoeinkommen aus den ersten 400 Euro besteht unverändert nur ein Freibetrag von 15 % angerechnet.
-
Liegt der Bruttolohn zwischen 900 Euro und 1.500 Euro, wird der die 900 Euro übersteigende Nettoeinkommensanteil ebenfalls mit 15 % von der Anrechnung ausgenommen.
-
Einkünfte aus einem Bruttolohn über 1.500 Euro werden voll auf die Geldleistungen angerechnet.
Weitere detaillierte Informationen zum neuen Arbeitslosengeld II gibt es in einer Broschüre des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und auf der Website zu Hartz IV, die die Bundesregierung eingerichtet hat.
Jetzt Rückruf anfordern
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.

